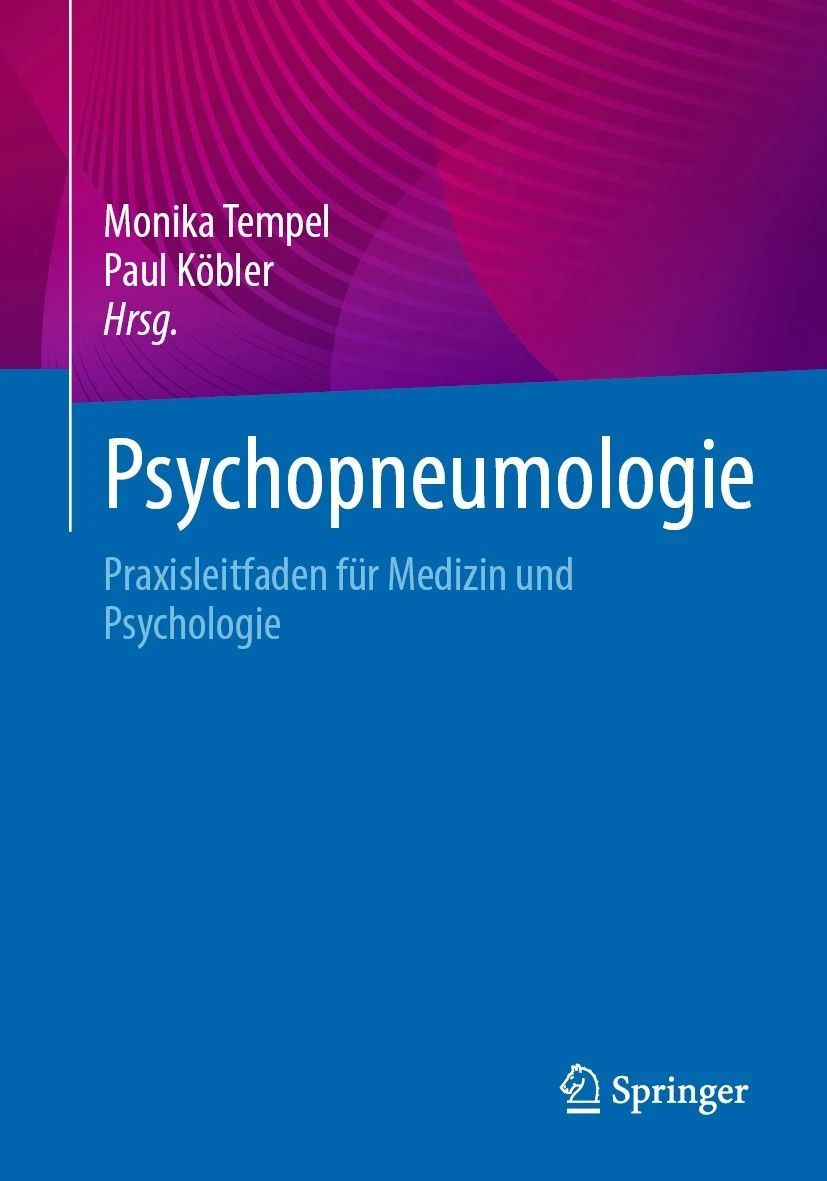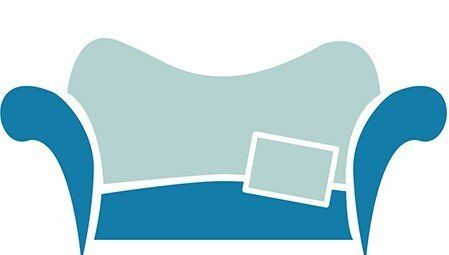Psychopneumologie Lexikon: V wie Verhaltensmedizin
Verhaltensmedizinische Ansätze auf der Grundlage des biopsychosozialen Modells für den Umgang mit chronischen Lungen-Erkrankungen
Verhaltensmedizin: Ein Definitionsversuch
Bereits 1977 wurde auf der Yale Konferenz für Verhaltensmedizin eine bis heute gültige Definition vorgeschlagen:
„Verhaltensmedizin ist das Gebiet, das sich mit der Entwicklung von verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnissen und Verfahren befaßt, die für das Verständnis von physischer Gesundheit und Krankheit von Bedeutung sind, sowie mit der Anwendung dieser Erkenntnisse und dieser Verfahren auf Diagnose, Prävention, Behandlung und Rehabilitation.“
Damit ist klar: Die Verhaltensmedizin zeigt viele Berührungspunkte und Überschneidungen mit anderen Disziplinen wie beispielsweise Psychosomatik, Gesundheitspsychologie, Psychophysiologie und Neurowissenschaften.
Grundlagen und Ziele der Verhaltensmedizin
Das biopsychosoziale Modell bildet das Fundament der Verhaltensmedizin.
Für die Verhaltensmedizin lassen sich Krankheiten nur dann verstehen und angemessen behandeln, wenn man den Wechselwirkungen zwischen Körper, Psyche und sozialen Beziehungen Rechnung trägt.
Ziel der Verhaltensmedizin ist somit die Zusammenführung der unterschiedlichen Faktoren, vor allem indem die Spaltung in „psychisch bedingte Krankheiten“ im Gegensatz zu „körperlich verursachten Krankheiten“ aufgegeben wird.
Gerade auch mit Blick auf chronische Lungen-Erkrankungen sind dynamische Wechselwirkungen zwischen psychischen und körperlichen Faktoren offensichtlich.
Modelle der Koexistenz von körperlichen und psychischen Störungen
Es gibt mehrere Modelle der Komorbidität bzw. Koexistenz von psychischen Störungen und körperlichen Krankheiten.
- Modell 1: Zufälliges Zusammentreffen (Koexistenz) – COPD und Depression
- Modell 2: Gemeinsame Ursache – (früh)kindlicher Streß bei Asthma und Angststörung
- Modell 3: Psychische Reaktion – COPD löst Depression oder Angststörung aus
- Modell 4: Psychosomatische Störung – Hyperventilations-Syndrom auf dem Boden einer Angststörung
- Modell 5: Pharmakologischer Zusammenhang – Cortisonstoß bei COPD bewirkt Depression
- Modell 6: Unerwünschte Arzneimittelwirkung – Verstärkung eines Asthma bronchiale durch nicht-selektive Beta-Blocker
- Modell 7: Psychologische Faktoren beeinflußen körperliche Krankheitsfaktoren – Depressivität führt über „Selbsttherapie“ durch Rauchen zu COPD
Drei Hauptrichtungen der Wechselwirkungen als verhaltensmedizinisches Rahmenmodell
Die oben genannten Modelle kann man nach drei Hauptrichtungen im Sinne eines verhaltensmedizinischen Rahmenmodells ordnen:
- Hauptrichtung 1: Psychische Faktoren als Ursachen bei der Krankheitsentstehung
- Hauptrichtung 2: Psychische Störungen als Folge der körperlichen Erkrankung
- Hauptrichtung 3: Einfluß psychischer Faktoren auf Krankheitsverlauf und Behandlung
Zu jeder der drei Hauptrichtungen lassen sich Beispiele aus dem Bereich „Lunge und Psyche“ finden.
Hauptrichtung 1: Psychische Faktoren als Ursachen bei der Krankheitsentstehung
Bei diesem Punkt spielt Streß in mehrfacher Hinsicht eine bedeutsame Rolle.
Streß kann zum einen als gemeinsame Ursache für die körperliche Krankheit (z. B. Asthma) und die psychische Störung (z. B. Angststörung) fungieren.
Außerdem gibt es Hinweise dafür, daß über Streßeinflüsse (vorgeburtlich, frühkindlich, im Erwachsenenalter) die Wechselwirkungen zwischen körperlicher und psychischer Störung auf vielfältige Weise beeinflußt werden:
- Einerseits wird das Risiko für das Auftreten sowohl von körperlicher, als auch von psychischer Störung erhöht.
- Andererseits spielt Streß vermutlich eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Risikoverhalten. So gibt es nachweisbare, bisher noch nicht im einzelnen geklärte Zusammenhänge zwischen Depression, Rauchen und chronischen Lungen-Erkrankungen.
Hauptrichtung 2: Psychische Störungen als Folge der körperlichen Erkrankung
Bei diesem Punkt bietet sich die Gelegenheit, auf die häufig vernachlässigten psychischen Nebenwirkungen der Therapie einer chronischen Lungen-Erkrankung hinzuweisen.
Relativ einfach nachvollziehbar sind in diesem Zusammenhang die psychischen Nebenwirkungen von Medikamenten, wie beispielsweise:
- Depressive Verstimmung bei Cortisongabe,
- Angst und Depressionen bei PDH (Daxas).
Schwieriger gestaltet sich ein Nachweis, wenn es etwa um den Zusammenhang zwischen der Verordnung einer Langzeit-Sauerstofftherapie (LTOT) und der Entwicklung einer depressiven Störung oder um die psychischen Langzeitfolgen nach einer Invasiven Beatmung (Post Intensive Care Syndrom = PICS) geht.
Hauptrichtung 3: Einfluß psychischer Faktoren auf Krankheitsverlauf und Behandlung
Dieser Punkt bildet (gerade auch bei chronischen Lungen-Erkrankungen) den Hauptansatz für verhaltensmedizinische Interventionen.
Subjektive Krankheits-Modelle, individuelle und dyadische Coping-Strategien, Gesundheits- und Risikoverhalten, Therapietreue (Adhärenz), Krankheitsverhalten (z. B. Vermeidungs- und Schonverhalten), belastende Lebensbedingungen (life events, daily hassles) – all diese psychischen Faktoren prägen entscheidend den Krankheitsverlauf und die Prognose von chronischen Lungen-Erkrankungen.
Die gute Nachricht: Diese psychischen Faktoren sind kein Schicksal, sondern durch maßgeschneiderte Interventionen beeinflußbar.
Fazit für die psychopneumologische Praxis
Die Verhaltensmedizin liefert der Psychopneumologie ein Deutungsmodell von chronischen Lungen-Erkrankungen auf dem Fundament des biopsychosozialen Modells.
Verhaltensmedizinische Interventionen tragen diesem Modell Rechnung, indem sie Einfluß nehmen auf:
- Verhalten (z. B. durch Problemlöse-Trainings und Selbstinstruktionen),
- kognitive Prozesse (z. B. Kognitive Verhaltenstherapie = CBT),
- emotionale Prozesse (z. B. Achtsamkeitsbasierte Verfahren),
- autonome Prozesse (z. B. Biofeedback),
- endokrine und immunologische Reaktionen.
Typische verhaltensmedizinische Interventionen sind:
- Aktiv (z. B. Motivierende Gesprächsführung),
- systematisch aufgebaut (häufig manualisiert),
- zeitlich begrenzt.
Welche Schlüsselrolle verhaltensmedizinische Interventionen beim Thema „Lunge und Psyche“ einnehmen, spiegelt sich in der Vielzahl der themenverwandten Beiträge wider, die an dieser Stelle verlinkt werden. Diese Beiträge liefern Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Interventionen und anschauliche Beispiele für deren Einsatz.
Themenverwandte Beiträge
Beitragschronik
- Erstveröffentlichung: 22.11.2022
Deine Fragen und Anmerkungen, Deine Kritik und Deine Themenwünsche sind herzlich willkommen!