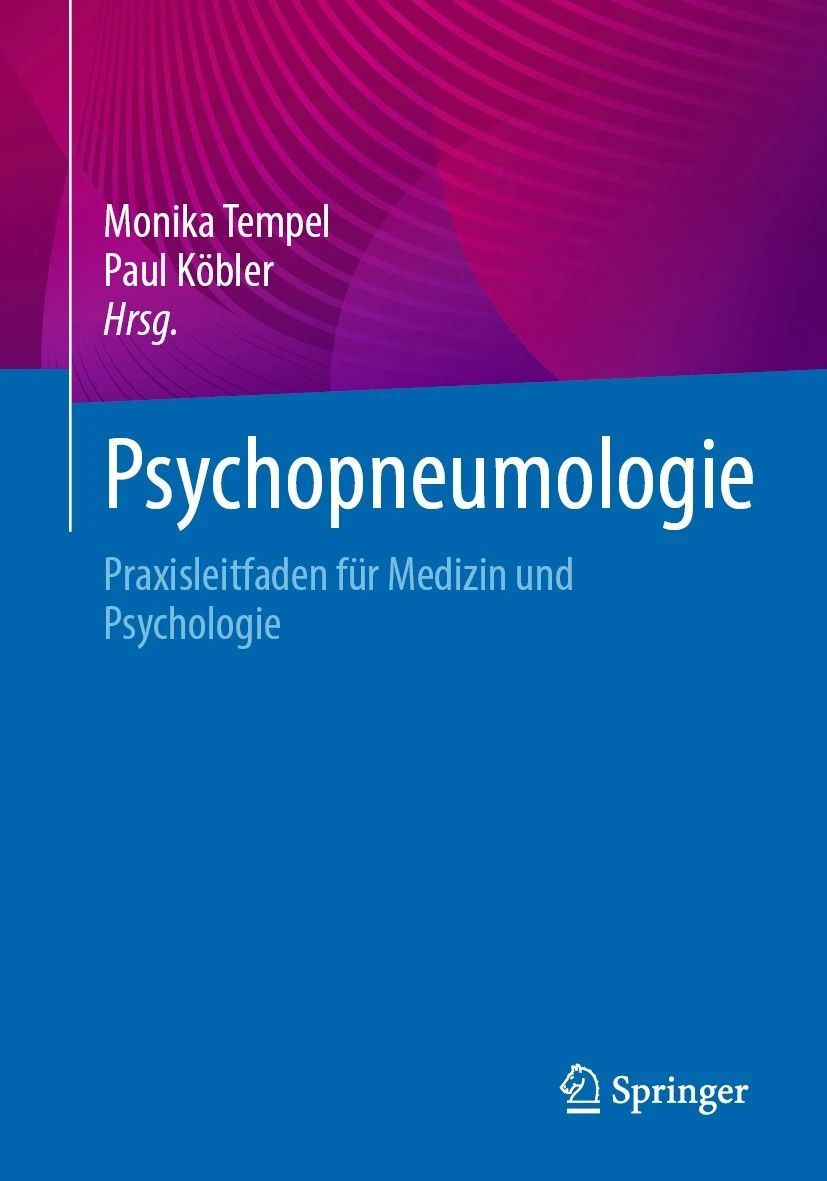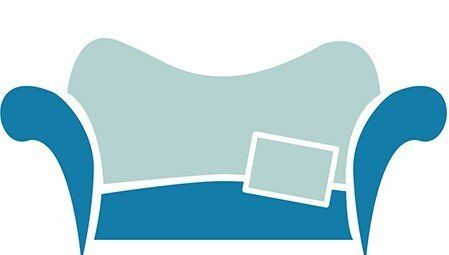Psychopneumologie Lexikon: U wie Ungewissheit
Wie umgehen mit dem unausweichlichen Thema „Ungewissheit“ bei chronischen Lungen-Erkrankungen?
Ungewissheit: Ein durchgängiges Thema bei Diagnose, Behandlung und Prognose
Ungewissheit ist allgegenwärtig bei chronischen Lungen-Erkrankungen. Sie kann zu emotionaler Belastung, zu Streß und in der Folge zu Ängsten und Depressionen führen.
Da auf Dauer wohl kein Patient mit chronischen Lungen-Erkrankungen (und auch kein pflegender Angehöriger) dem Gefühl der Ungewissheit entkommen kann, ist ein vertieftes Verständnis dieser Erfahrung notwendig, um durch gezielte Unterstützung Hoffnung und Motivation zu stärken.
Ungewissheit im Krankheitsverlauf
Fast alle Patienten mit seltenen Lungenerkrankungen schildern Erfahrungen mit Ungewissheit im Krankheitsverlauf.
- Ungewissheit vor der Diagnose: „Ich spüre die Krankheitslast, kenne aber keine Diagnose.“
- Ungewissheit bei der Behandlung: „Ich kenne die Diagnose, finde aber keine fachkundigen Behandler.“
- Ungewissheit bei der Prognose: „Ich muß die Krankheitslast nach der Diagnose von Tag zu Tag tragen bei begrenzter Lebenszeit.“
Ungewissheit zeigt sich also durchgängig und unvermeidbar.
Voraussetzungen und Auswirkungen der Ungewissheit
"Medizin ist die Wissenschaft der Ungewissheit und die Kunst der Wahrscheinlichkeit."
Bereits 1922 legte kein geringerer als William Osler mit diesem Aphorismus einen Grundstein zum "Illness Uncertainty"-Modell.
1988 veröffentlichte Mishel MH einen ersten Entwurf des "Uncertainty in Illness"-Konzeptes (UIT = Uncertainty in Illness Theory). 1990 folgte eine Rekonzeptualisierung (RUIT = Reconceptualized Uncertainty in Illness Theory).
Bis heute werden Varianten und Erweiterungen publiziert (z. B. McCormick KM, 2002 oder Nanton V et al, 2016 oder Eppel-Meichlinger J et al, 2022).
Im Prinzip basiert das "Illness Uncertainty"-Konzept auf dem Streß-Modell von Lazarus RS und Folkman S (1984).
In dem an Mishel MH angelehnten Modell (UIT) werden die Voraussetzungen und Auswirkungen der Ungewissheit bei Krankheiten (Illness Uncertainty) in ihren komplexen Verflechtungen dargestellt.
Zu den Voraussetzungen tragen drei Faktoren-Gruppen bei:
- Biologische Faktoren (Krankheitsschwere, Symptomausprägung, Symptomvertrautheit)
- Psychologische Faktoren (Erlernte Hilflosigkeit, Gefühle der Beherrschbarkeit, Kontrollüberzeugung)
- Soziale Faktoren (Vertrauenswürdige Experten, soziale Unterstützung, Bildung)
Diese Faktoren bestimmen im wesentlichen, ob die Erfahrung von Ungewissheit bei Krankheit als Gefahr oder als Herausforderung bewertet wird. Gemäß dem Streß-Modell von Lazarus und Folkman entscheidet diese Bewertung über die Auswirkungen der belastenden Erfahrung.
Mehrere Pfade sind möglich:
- Wird die Ungewissheit als Herausforderung bewertet, so sind eine Stabilisierung des Zustandes und eine positive Anpassung wahrscheinlich.
- Wird die Ungewissheit als Gefahr bewertet, so resultiert daraus im ungünstigen Fall psychologischer Distress. Im günstigen Fall gelingt durch angemessenes Coping auch hier eine positive Anpassung.
Facetten der Ungewissheit
Ungewissheit bei chronischen Lungen-Erkrankungen ist nicht nur durchgängig und unvermeidbar, sondern auch vielschichtig und komplex.
Die grundlegende Theorie zur Ungewissheit bei Krankheit (UIT von Mishel MH) führt vier Faktoren an:
- Mehrdeutigkeit,
- Komplexität,
- Inkonsistenz (Widersprüchlichkeit),
- Unvorhersehbarkeit.
Zu 1. Mehrdeutigkeit
Symptome können mehrdeutig sein. Luftnot beispielsweise kann vielerlei Ursachen haben. Als mehrdeutiges Symptom bestimmt Luftnot Denken, Fühlen und Handeln der Patienten und zeigt nachweislich Auswirkungen auf alle Phasen des Krankheitsprozesses.
Zu 2. Komplexität
Bei chronischen Lungenerkrankungen sind die Pfade im Diagnose- und Behandlungs-Dschungel häufig sehr verschlungen und für Patienten schwer verständlich.
Zu 3. Inkonsistenz (Widersprüchlichkeit)
Eigene Krankheits-Erfahrungen können für Patienten ebenso widersprüchlich sein wie Erfahrungen mit Behandlern.
Zu 4. Unvorhersehbarkeit
Viele Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen leider unter der ungewissen Prognose. Sie wissen nie, wie sie sich morgen fühlen werden – oder ob und wie lange es ein „Morgen“ für sie gibt.
Als Meßinstrument für Ungewissheit hat sich, vor allem zu Forschungszwecken, die Mishel Uncertainty in Illness Scale (MUIS) etabliert. Für den Einsatz in der Praxis existiert inzwischen eine Kurzform (MUIS-C = Mishel Uncertainty in Illness Scale – Community Form).
Weitere Klassifikationen von Ungewissheit bei Krankheit
Ein neueres Konzept zur Ungewissheit bei Krankheit (Morse JM, 2000) benennt die folgenden drei Facetten:
- Wahrscheinlichkeit („Ich fürchte den nächsten Winter – dann geht es mir meist schlechter.“)
- Zeitabhängigkeit („Ich kann nicht im voraus planen.“)
- Wahrnehmung („Manchmal habe ich Luftnot aus heiterem Himmel – dann weiß ich nicht, was ich tun soll.“)
Auf die subjektiven Erfahrungen der Patienten zielt eine aktuellere Systematik (Kaspar J et al, 2008) mit folgenden Ungewissheits-Bereichen:
- Soziale Einbindung,
- Krankheitszustand,
- Psychosoziale Leistungs- und Funktionsfähigkeit,
- Ursachenzuschreibung (Kausalattribution),
- Beziehung zu Behandlern,
- Behandlungsoptionen.
Dieser kurze Abriß der Klassifikationen macht bereits deutlich: Patienten mit chronischen Lungen-Erkrankungen sind durch Ungewissheit in vielerlei Gestalten herausgefordert.
Trotz Ungewissheit zum Experten für das Leben mit der Krankheit werden
Patienten mit chronischen Lungen-Erkrankungen spüren rasch: Informationen sind wichtig. Doch Informationen allein genügen nicht – zumal diese mitunter widersprüchlich, komplex, verwirrend sind. Dadurch können Ängste, Depressionen, das Gefühl von Kontrollverlust und Atemnot sogar noch verstärkt und die Lebensqualität ungünstig beeinflußt werden.
Um besser mit der ständigen Ungewissheit leben zu lernen, ist eine Kombination von Strategien hilfreich:
- Kognitive Strategien
Patienten informieren sich, z. B. im Internet, bei Selbsthilfe-Organisationen, etc.
„Früher hat der Arzt mir etwas erklärt. Heute muß ich dem Arzt erst mal erklären, was ich habe und worauf er achten muß.“
- Emotionale Strategien
Patienten sorgen für ihre innere Balance, z. B. durch Achtsamkeit, Fokussierung auf Positives
„Ich nehme die Krankheit ernst, aber versuche, entspannt zu bleiben.“ oder: „Es klingt abgedroschen, aber: Ich freue mich tatsächlich mehr über Kleinigkeiten.“
- Verhaltensstrategien
Patienten entwickeln (evtl. gemeinsam mit den Angehörigen) eine persönliche „Normalität“, z. B. durch Anpassung von Belastung und Schonung, Selbstmanagement, etc.
„Keiner redet mit Opa, bis er den Berg hochgelaufen ist.“
Seite an Seite: Wie Angehörige mit der Ungewissheit umgehen lernen
Nicht nur die Patienten, auch Angehörige sind Betroffene. Auch sie leiden unter der Ungewissheit in mehrfacher Hinsicht:
- „Was wird aus meinem kranken Partner?“
- „Wie verändert die Krankheit unsere Beziehung?“
- „Was wird aus mir?“
Das sind nur ein paar der zahlreichen Fragen, die sich Angehörigen aufdrängen.
Wie können Angehöroge die Patienten mit chronischen Lungen-Erkrankungen hilfreich unterstützen und dabei selber stabil bleiben?
Die Ungewissheit führt manchmal zu sehr wechselhaften und widersprüchlichen Verhaltensweisen bei den Erkrankten: Zuversicht schlägt von einem Augenblick zum nächsten in Pessimismus um; Hoffnung und Verzweiflung liegen dicht beieinander. Da fällt es manchem Angehörigen schwer, verständnisvoll zu reagieren.
Im Grunde geht es nicht ums Verstehen, sondern ums Beistehen. Angehörige müssen weder kluge Sprüche noch Patentrezepte liefern. Entscheidend ist der Mut, präsent zu sein – Seite an Seite die Ungewissheit auszuhalten. Im gemeinsamen Aushalten der Ungewissheit erfahren Patienten und Angehörige Beruhigung.
Ungewissheit bei seltenen Erkrankungen mit Lungenbeteiligung: Eine besondere Herausforderung auch für die Behandler
Eine besondere Herausforderung stellt Unbewißheit bei den sogenannten Seltenen Erkrankungen dar.
Wenn eine Krankheit bei weniger als einem von 2.000 Patienten auftritt, lernt ein Arzt Betroffene möglicherweise nur im Hörsaal oder im Lehrbuch kennen. Entsprechend lang sind die Irrfahrten mancher Patienten mit seltenen Lungen-Erkrankungen (wie AATM, Lungenfibrose, Sarkoidose, LAM) bis zur Diagnosestellung. Hier können regelmäßige Fortbildungen für Behandler oder der Einsatz von Datenbanken (z. B. von Orphanet) hilfreich sein.
Doch mit der Diagnosefindung ist die Ungewissheit nicht zu Ende. Durch ein patientenorientiertes Diagnose-Gespräch kommt es zwar häufig zu einer kurzzeitigen Entlastung und Beruhigung – vor allem dann, wenn konkrete Therapiemöglichkeiten angeboten werden können.
Gerade bei seltenen Lungenerkrankungen mit häufig unklarer Prognose löst die Diagnose jedoch auch neue Ungewissheit aus: beispielsweise hinsichtlich Krankheitsverlauf und begrenzter Lebenszeit. Hier ist neben interdisziplinärer Zusammenarbeit der Experten vor allem die verläßliche, möglichst kontinuierliche Ansprechbarkeit und Präsenz der Behandler gefordert.
Fazit für die psychopneumologische Praxis
Ungewissheit ist ganz offensichtlich ein wichtiges Thema für die Psychopneumologie.
Ansatzpunkte zu einer gezielten Unterstützung für Betroffene gibt es bereits – so beispielsweise eine Ungewissheits-Intervention bei COPD.
Wie sieht eine Intervention zum Umgang mit Ungewissheit aus?
Die ursprünglich für onkologische Patienten entwickelte Intervention (Mishel et al., 2005) setzt sich wie folgt zusammen:
- kognitive Umstrukturierung,
- Vermittlung von Krankheitswissen,
- Verbesserung der Behandler-Patienten-Kommunikation,
- Stärkung der sozialen Unterstützung.
Angepasst für COPD-Patienten umfaßt eine Intervention zum Ungewissheits-Management beispielsweise:
- kognitive Strategien,
- verhaltensbezogene Strategien,
- Interventions- und Feedback-Kontakte.
Wie werden die kognitiven Strategien der „Ungewissheits-Intervention bei COPD“ eingeübt?
Nach einer Verhaltensanalyse werden gezielt Strategien besprochen und geübt, die beim Auftreten von Ungewissheits-Auslösern ausgeführt werden sollen.
Beispiel: „Atemnot-Angst-Diskriminierungs-Übung“ – Ist es meine Psyche (Angst) oder ist es meine Lunge (Exazerbation)?
Wie lassen sich die verhaltensbezogenen Strategien vermitteln?
Hier bieten sich Selbstmanagement- Materialien (Audio CD, Broschüre, App, etc.) an. Wichtig ist die zweigleisige Ausrichtung auf:
- COPD-Informationen
- Ungewissheit und Coping bei COPD
Die COPD-Informationen umfassen beispielhaft folgende Themen:
- Was ist COPD?
- Ursachen und Risikofaktoren für COPD
- Diagnose und Behandlung der COPD
- COPD-Exazerbationen
- COPD-Prognose
Das „Ungewissheit und Coping“-Modul behandelt Themen wie:
- Was ist Ungewissheit?
- Wie beeinflusst Ungewissheit das tägliche Leben?
- Was löst COPD-bezogene Ungewissheit aus?
- Wie gehe ich mit COPD-bezogener Ungewissheit um?
- Was beeinflusst meinen Umgang mit COPD-bezogener Ungewissheit?
- Beispiele für den adäquaten Umgang mit COPD-bezogener Ungewissheit
- Kraftquellen
Wichtig für den Erfolg: die Interventions- und Feedback-Kontakte
Bei vier etwa halbstündigen wöchentlichen Folgekontakten führen die Patienten jeweils eine Bewältigungs-Strategie aus:
- Ablenkung
- beruhigendes Selbstgespräch
- Entspannungsübung
- Wohlfühl-Imagination
Die Patienten werden angehalten, die Bewältigungs-Strategien immer dann anzuwenden, wenn sie mit einem Auslöser von Ungewissheit (real oder antizipiert = vorweggenommen) konfrontiert sind. Die Selbstmanagement-Materialen (CD, Broschüre, App, etc.) werden erläutert. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Interventionen die medizinische Standard-Behandlung nicht ersetzen, sondern allenfalls krankheitsbezogene Ungewissheit reduzieren und zu einem besseren Umgang mit Krankheits-Problemen anleiten können.
Themenverwandte Beiträge
Beitragschronik
- Erstveröffentlichung: auf der Website „Sauerstoff und Sinn“
- Aktualisierung: 8.11.2022
Quellen und weiterführende Literatur:
- Mishel, M. H. (1990). Reconceptualization of the uncertainty in illness theory. Image: The Journal of Nursing Scholarship, 22(4), 256-262.
- Mishel, M. H. (1999). Uncertainty in chronic illness. Annual review of nursing research, 17(1), 269-294.
- Jiang, X., & He, G. (2012). Effects of an uncertainty management intervention on uncertainty, anxiety, depression, and quality of life of chronic obstructive pulmonary disease outpatients. Research in nursing & health, 35(4), 409-418.
- Hoth, K. F., Wamboldt, F. S., Strand, M., Ford, D. W., Sandhaus, R. A., Strange, C., ... & Holm, K. E. (2013). Prospective impact of illness uncertainty on outcomes in chronic lung disease. Health Psychology, 32(11), 1170.
- Hoth, K. F., Wamboldt, F. S., Ford, D. W., Sandhaus, R. A., Strange, C., Bekelman, D. B., & Holm, K. E. (2015). The social environment and illness uncertainty in chronic obstructive pulmonary disease. International journal of behavioral medicine, 22(2), 223-232.
Deine Fragen und Anmerkungen, Deine Kritik und Deine Themenwünsche sind herzlich willkommen!