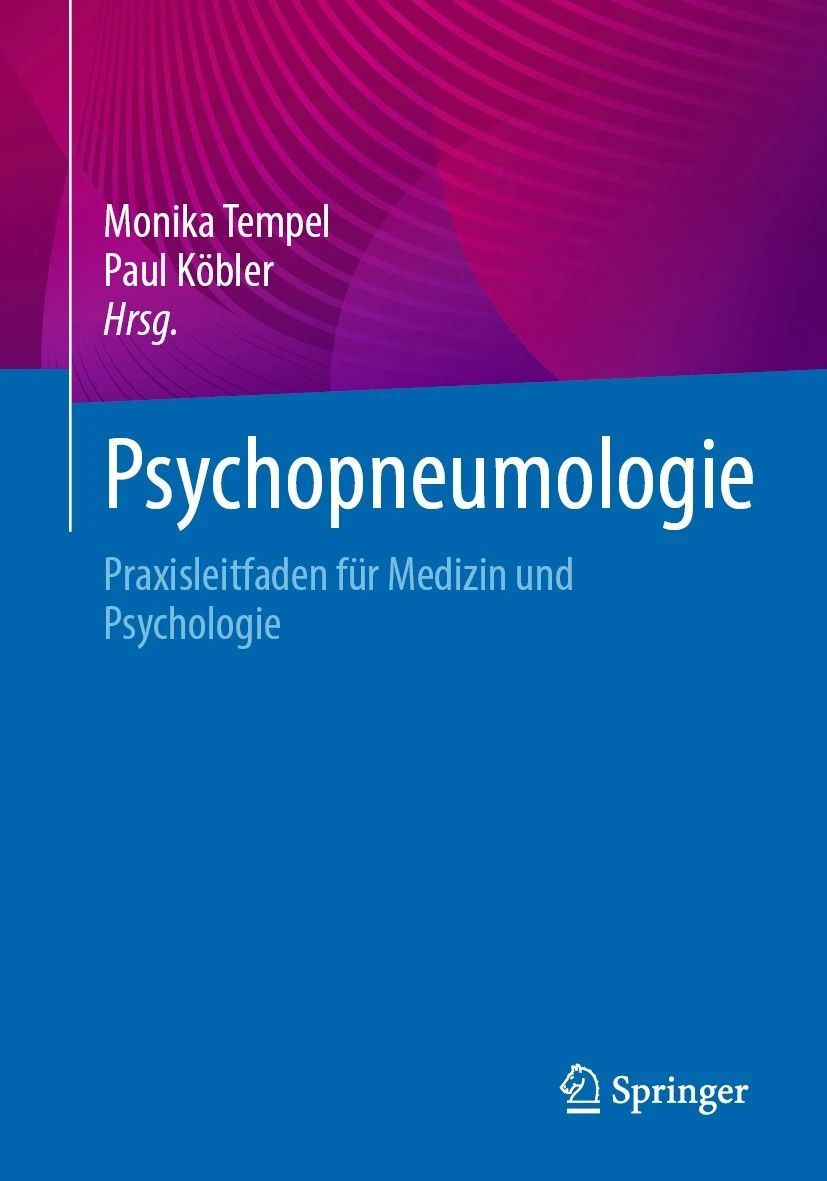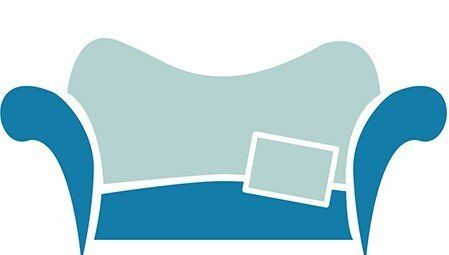Tuberkulose und Psyche: Belastungen im Behandlungsverlauf
Jede Patienten-Reise verläuft anders und stellt Betroffene vor ganz besondere emotionale Herausforderungen.
Behandlungsverlauf
Die Behandlung mit Tuberkulostatika ist eingeleitet. Jetzt beginnen für Betroffene entscheidende Monate mit Erfahrungen, die für manche zu bedrückenden Belastungen werden können. Manchmal lassen sich sogar bleibende psychische Spuren nicht vermeiden.
Fatigue: „Ich war einfach zu müde für alles!“
„Am schlimmsten Punkt meiner Tuberkulose hatte ich die Nase voll, aber ich war zu müde, um mich noch über irgendetwas aufzuregen. Es war unglaublich hart, einfach nur den Tag zu überstehen, sich morgens vom Bett auf das Sofa und abends vom Sofa wieder ins Bett zu schleppen.“
Fatigue, die unendliche Müdigkeit und Schlappheit, kann bei Tuberkulose sowohl ein Krankheitssymptom als auch eine Nebenwirkung der Medikamente oder eine Kombination von beiden sein.
Fatigue ist ein quälendes Symptom und nicht vergleichbar mit Erschöpfung nach gesunder Anstrengung (selbst nach Extrembelastungen). Deshalb gibt es eine eigens für das Symptom „Müdigkeit“ entwickelte Leitlinie. Diese listet bei den möglichen Ursachen für eine Fatigue ausdrücklich die Tuberkulose auf.
Die Leitlinie liefert auch allgemeine Hinweise auf sinnvolle Unterstützungsansätze. Es wird betont, daß beim Umgang mit Fatigue immer ein bio-psycho-sozialer Ansatz eingehalten werden sollte.
Scham: „Ich zog mich immer mehr zurück.“
„Ich war praktisch an das Sofa gefesselt und lebte zurückgezogen in meiner Wohnung. Es ging so weit, dass ich mich nur noch in der Dämmerung aus dem Haus wagte. Warum? Weil ich mich schämte, wegen der Akne durch die Medikamente, und weil ich abgemagert aussah wie ein Hungerhaken. Ich fühlte mich wie ein räudiger Hund.“
Die oben geschilderten Schamgefühle klingen extrem, können aber sensible Betroffene durchaus über längere Zeit quälen.
Als Auslöser dieser Schamgefühle können, neben den körperlich sichtbaren Nebenwirkungen der Tuberkulostatika und der Tuberkulose-bedingten Kachexie (Abmagerung), untergründige Schuldgefühle wirken.
Schuldgefühle: „Ich habe unter schrecklichen Schuldgefühlen für die Menschen gelitten, die ich angesteckt habe.“
„Es ist nicht leicht, mit dem Gedanken zu leben, daß ich andere mit Tuberkulose angesteckt haben könnte. Es entlastet nicht wirklich, wenn Du Dir immer wieder vorsagst, daß es ja unwillentlich geschehen ist in der Zeit, in der Du selbst noch keine Diagnose hattest.“
Verstärkt werden Schamgefühle zudem, wenn sich zu diesen Belastungen noch stigmatisierende Verhaltensweisen des Umfeldes gesellen.
Stigma: „Manche Leute meiden Dich, wenn sie von der TB erfahren.“
„Ich habe seltsame Reaktionen von Menschen erlebt, die ich kenne und liebe, als sie über meine Krankheit informiert wurden. Egal, wie sehr ich den Leuten erklärte, dass die Krankheit zu diesem Zeitpunkt nicht ansteckend war ... einige Leute wollten nicht in meine Nähe kommen wollten, weil sie wussten, dass ich TB hatte und weil sie Angst hatten, sich anzustecken.“
Angesichts dieser Erfahrungen ist es nicht verwunderlich, daß sich bei vielen Tuberkulose-Patienten im Behandlungsverlauf Ängste oder depressive Symptome entwickeln oder verstärken.
Angst und Depression: „Es war eine schlimme Zeit.“
„Die Ernüchterung kam wöchentlich, als ich nicht wie üblich nach 2-3 Wochen negativ getestet wurde, sondern erst nach ca. 3 Monaten. Ich hatte Angst, dass die Therapie doch nicht wie gewünscht anschlägt… Wegen einer nicht erkannten Nebenwirkung der Medikamente stand die Vermutung im Raum, dass sich die TBC auf die Knochen ausgebreitet haben könnte. So war ich weiterer - unnötiger - psychischer Belastung ausgesetzt.“
Das gemeinsame Auftreten von Tuberkulose und Depression ist so häufig, daß einige Forscher sogar von einer „Tuberkulose-Depression-Syndemie“ (Epidemie durch gleichzeitig auftretende Tuberkulose und Depression) sprechen.
Diese typische Komorbidität hat wahrscheinlich vielfältige Ursachen:
- Entzündung und Immunsuppression,
- Nebenwirkungen der Tuberkulostatika,
- Dysregulation der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (hormonelle „Streß-Achse“),
- Isolation und Stigmatisierung.
Die lange Liste der möglichen psychischen Belastungen zeigt, wie wichtig eine durchgehende psychosoziale Unterstützung im gesamten Behandlungsverlauf der Tuberkulose ist.
Unterstützung während des Behandlungsverlaufs bei Tuberkulose
Welche Möglichkeiten einer psychopneumologischen Begleitung bieten sich während der monatelangen (unter ungünstigen Umständen sogar jahrelangen) Behandlungsphase bei Tuberkulose an?
Auf Wirksamkeit hin untersucht sind bisher:
- Anti-Stigma-Intervention,
- Akzeptanz- und Commitment-Therapie bei Tuberkulose und Depression,
- Psychologische Intervention bei Tuberkulose und Angst.
Anti-Stigma-Intervention
Bei diesem Thema lohnt der Blick auf Tuberkulose-Programme in Afrika, Lateinamerika und Asien. In den dortigen ländlichen Regionen mit hoher Tuberkulose-Inzidenz hat sich der Anti-Stigma-Ansatz „TB Club“ bewährt.
Ein TB Club setzt sich in der Regel aus drei bis zehn Tuberkulose-Patienten zusammen und wird von geschulten Tuberkulose-Fachkräften organisiert. Sie treffen sich wöchentlich, um soziale Unterstützung zu bieten, den Transport zu Kliniken zu organisieren, die Therapietreue zu fördern und die Nebenwirkungen der Behandlung zu überwachen. Zudem erhalten die Betroffenen im TB Club eine psychologische Beratung, um ihre Selbstwirksamkeit zu stärken, die oft durch das Stigma der TB beeinträchtigt wird.
In Deutschland gibt es keine TB Clubs. Hier liegt es in der Verantwortung von Betroffenen, Behandlern und öffentlichen Institutionen, die Krankheit Tuberkulose zu entstigmatisieren.
Für eine persönliche Anti-Stigma-Haltung bieten sich therapeutische Ansätze für den Umgang mit krankheitsbedingten (Körperbild-)Veränderungen an. Diese Interventionen konzentrieren sich im wesentlichen auf die Stärkung der Selbstwirksamkeit und auf eine selbstwert-bewußte Kommunikation.
Vielleicht kann auch ein „digitaler TB Club“ im Rahmen der Selbsthilfe zu einer besseren Akzeptanz der Tuberkulose bei den Betroffenen und in ihrem Umfeld beitragen.
Deshalb an dieser Stelle wieder der Hinweis auf das Selbsthilfe-Projekt von Carolin Fuchs: Mit Tuberkulose leben. Mit ihrem Internet-Auftritt möchte sie Betroffene vernetzen, um sich mit der Diagnose auseinanderzusetzen, Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterstützen.
- Link zu Mit Tuberkulose leben
Akzeptanz- und Commitment-Therapie bei Tuberkulose und Depression
Eine speziell für Tuberkulose-Patienten angepaßte Akzeptanz- und Commitment-Therapie auf der Grundlage des Modells der Gesundheitsüberzeugungen (Health Belief Model) kann laut einer Studie den Grad der Depression bei Tuberkulose-Patienten signifikant besser senken als eine allgemeine Gesundheits-Schulung. Diese Intervention kann von Krankenschwestern eingesetzt werden, um Tuberkulose-Patienten bei der Überwindung psychologischer Probleme während der Behandlung zu helfen.
In der ersten Sitzung dieser Intervention geht es um Akzeptanz, kognitive (gedankliche) Ablenkung und das Vertrauen der Patienten in die Behandlung. Verhaltensweisen, Erfahrungen oder Gefühle, die den Patienten während der Behandlung belasten, werden identifiziert und die Akzeptanz des Patienten und seine Gesundheitsüberzeugungen ermittelt.
In der zweiten Sitzung geht es um den gegenwärtigen Moment und die Werte des Patienten. Die Werte des Patienten, die seine Erfahrung prägen, werden ermittelt.
In der dritten Sitzung geht es um engagiertes Handeln und das Selbst als Kontext (das Selbst in der Beobachter-Perspektive). Es wird geübt, Ereignisse im Zusammenhang mit Krankheit und Behandlung zu identifizieren und auf der Grundlage der vom Patienten gewählten Werte zu akzeptieren.
In der vierten Sitzung geht es um das Engagement für die Behandlung. Dieses Engagement des Patienten (besonders für die Einhaltung der Medikamente) wird aufgrund der eigenen Wertewahl gefördert.
[Quelle: Sari, G. M., Amin, M., & Hidayati, L. (2020). Acceptance and commitment therapy on depression of pulmonary tuberculosis patient: an intervention based on the health belief model. INDONESIAN NURSING JOURNAL OF EDUCATION AND CLINIC (INJEC), 5(2), 107-115.]
Psychologische Intervention bei Tuberkulose und Angst
In einer randomisierten Studie war einen Monat nach einer psychologischen Intervention das Angst-Level der Tuberkulose-Patienten in der Interventionsgruppe signifikant niedriger als bei den Patienten der Kontrollgruppe. Bei einem Follow-Up nach einem Jahr war die Lebensqualität in der Interventionsgruppe signifikant höher als die der Kontrollgruppe.
Die psychologische Interventionsgruppe umfaßte folgende Maßnahmen:
- Fürsorge und Sympathie für die Patienten entwickeln und eine gute Beziehung zu ihnen aufzubauen.
- Den psychologischen Zustand des Patienten verstehen, um seine Fragen zu beantworten und ihn sorgfältig zu beraten.
- Eine angemessene psychologische Unterstützung bei Angst, Furcht, Depression und Enttäuschung der Patienten anbieten.
- Den Patienten helfen, die Tuberkulose richtig zu verstehen.
- Austausch mit den Patienten mindestens einmal pro Woche.
- Die Medikation, die Tests und die psychologische Situation jedes einzelnen Patienten kennen und verstehen und ihn jederzeit psychologisch unterstützen.
[Quelle: LI, H. Y., & QIN, F. J. (2020, July). Effect of Psychological Intervention on Anxiety of College Students With Pulmonary Tuberculosis. In 2020 5th International Conference on Humanities Science and Society Development (ICHSSD 2020) (pp. 13-14). Atlantis Press.]
Der vierte Beitrag der Blog-Serie „Tuberkulose und Psyche“ befaßt sich mit der Situation der Angehörigen und dem Leben mit Tuberkulose.
Themenverwandte Beiträge
Beitragschronik
- Erstveröffentlichung: 15.3.2022
Deine Fragen und Anmerkungen, Deine Kritik und Deine Themenwünsche sind herzlich willkommen!