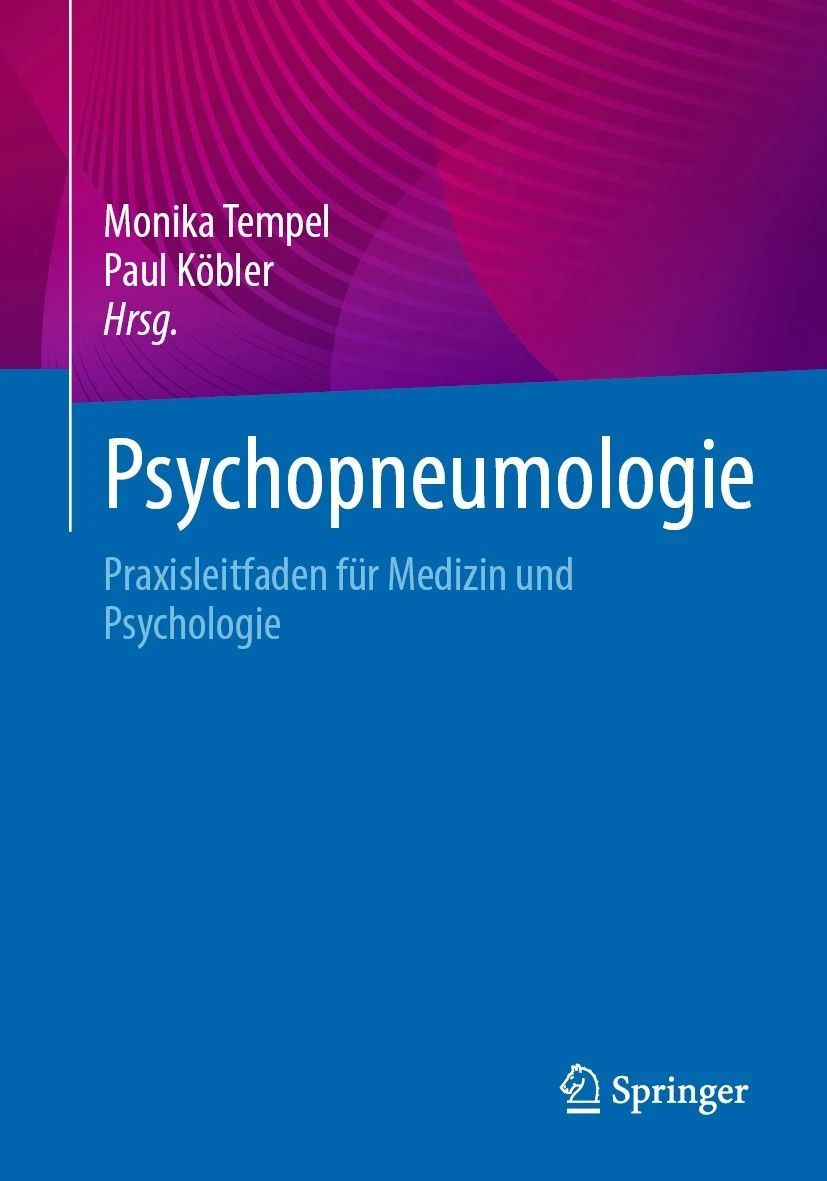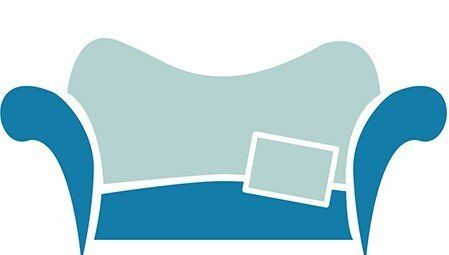Alpha-1-Antitrysin-Mangel und die Psyche: Belastungen – Bedürfnisse – Behandlungsperspektiven (Teil 2)
Wünschenswerte Angebote für die psychischen Belastungen bei AATM – dargestellt anhand der Erfahrungen von Betroffenen mit Motivation, Adhärenz, Akzeptanz und Selbst-Management.
Einblicke in das Leben mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel
Im Blog-Beitrag „Alpha-1-Antitrysin-Mangel und die Psyche: Belastungen – Bedürfnisse – Behandlungsperspektiven (Teil 1)“ werden die Hintergründe zu diesem Thema vorgestellt und zudem die drei „Alphas“, die von ihren Belastungen und Bedürfnissen im Zusammenhang mit der AATM-Diagnose berichten.
Hier noch einmal die wichtigsten Hintergrund-Informationen:
Einige Erfahrungen von AATM-Patienten und ihren Angehörigen ähneln sich. Manchen Erfahrungen unterscheiden sich jedoch. Sie sind so unterschiedlich wie die persönliche oder gesellschaftliche Situation der Betroffenen. Allen gemeinsam ist die Erfahrung, daß ein Leben mit der seltenen Erkrankung Alpha-1-Antitrypsin-Mangel für Patienten und Angehörige eine ganz besondere Herausforderung darstellt. Dies gilt in hohem Maße auch für Belastungen im Hinblick auf AATM und die Psyche.
Im Verlauf von chronischen, bisher nicht heilbaren und mitunter lebenszeitverkürzenden Erkrankungen gibt es mehrere Phasen und Schwellensituationen.
Beispielhaft und stark schematisierend (!) dargestellt sind dies:
- Phase: Abklärung der Symptomatik
- Schwellensituation: Diagnose-Mitteilung und Therapieentscheidung
- Phase: Einleitung der Therapie
- Schwellensituation: Motivation und Adhärenz (Therapietreue)
- Phase: Stabilität
- Schwellensituation: Akzeptanz und Selbst-Management
- Phase: Instabiliät und beginnende Verschechterung
- Schwellensituation: Coping
- Phase: Fortschreitende Verschlechterung und Lebensende
- Schwellensituation: Progredienzangst und End-of-Life-Ängste
Der folgende Blog-Beitrag vermittelt zunächst kurz einen Eindruck von den geschilderten psychischen Belastungen im Krankheitsverlauf nach der Verarbeitung der AATM-Diagnose. Im Anschluß versucht er, die zugrundeliegenden Bedürfnisse zu ermitteln, um schließlich ein wünschenswertes, idealtypisches Angebot aus dem Repertoire der Psychopneumologie vorzuschlagen.
Wichtiger Hinweis: Die Vorschläge sind überwiegend erfahrungsbasiert und nur als Anregung zu einem lebhaften Austausch gedacht, um Menschen mit Seltenen Erkrankungen eine möglichst umfassende Unterstützung im Krankheitsverlauf bieten zu können.
Patienten-Erfahrung: Motivation und Adhärenz
„… Im Alltag aktiv zu bleiben, Muskelstärkungsübungen, die Ausdauer zu erhalten oder zu verbessern, war für mich sehr wichtig, sowie ein gesundes Gewicht und eine ausgewogene Ernährung beizubehalten…
… Es ist für jeden wichtig, in seine Gesundheit zu investieren, und wir "Alphas" brauchen ein wenig mehr Zeit dafür. Ich mache etwa eine halbe Stunde Training pro Tag, plus je eine Stunde Atemtherapie und Lungensport einmal pro Woche…“
(Marion Wilkens)
„… Ich muss auf meine Gesundheit achten,… Meine regelmäßigen Behandlungen im Krankenhaus und medizinische Untersuchungen haben hohe Priorität und sind
zeitaufwendig…
… Wenn ich das Krankenhaus verlasse, ist mir immer ein bisschen schwindlig, manchmal mit Kopfschmerzen, wegen des Proteinschocks. Alles in allem brauche ich einen halben Tag, um mich zu erholen…“
(Frank Willersinn)
Patienten-Bedürfnisse
- Motivation zur Lebensstil-Modifikation,
- Stärkung der Adhärenz im Hinblick auf Therapie-Maßnahmen und Lebensstil-Interventionen.
Wünschenswerte Angebote im Rahmen einer Kollaborativen Versorgung
Die oben zitierten Aussagen von AATM-Betroffenen vermitteln ein sehr eindrückliches Bild von typischen alltäglichen und dauerhaften Patienten-Belastungen. Es ist auch erkennbar, daß sich daraus sehr individuelle Unterstützungsbedürfnisse ergeben können.
Für COPD-Patienten wurden Zusammenhänge zwischen Angst, Depression und Adhärenz und Auswirkungen dieser Faktoren auf den Krankheitsverlauf durch Studien nachgewiesen. Deshalb erscheint es sinnvoll, auch AATM-Patienten über diese Zusammenhänge und Auswirkungen aufzuklären und ihnen regelmäßig (z. B. im Rahmen von Kontrolluntersuchungen) ein kombiniertes Screening auf Motivation, Adhärenz, Angst und Depression anzubieten.
Ergeben sich durch die Suchtestung Hinweise auf Probleme in einem oder mehreren dieser Bereiche, so können in einem vertrauensvollen Auswertungs-Gespräch individuelle Unterstützungsangebote unterbreitet werden.
Als Unterstützungsangebote können sowohl maßgeschneiderte Motivations- oder Adhärenz-Interventionen notwendig sein, als auch Interventionen zum Umgang mit Depression oder Angst.
Vorteile des Kollaborativen Ansatzes für Motivation und Adhärenz
Um bei den täglichen, zeitaufwändigen Therapie-Maßnahmen „am Ball“ zu bleiben, sind auf die Dauer mehr als nur aufmunternde Sätze gefragt. Gerade bei bedrückter Stimmungslage oder bei ängstlicher Besorgtheit der Betroffenen können gutgemeinte Stupser von Außenstehenden mitunter gegenteilige Effekte bewirken und Motivation und Adhärenz schwächen.
Ein kollaborativ arbeitendes Behandlungsteam bietet die Chance, echte depressive Verstimmungen und dauerhafte Ängste frühzeitig von den üblichen Befindlichkeitsschwankungen zu unterscheiden, bevor sie negative Auswirkungen auf Motivation und Adhärenz entfalten können.
Die Beobachtungen können einfühlsam angesprochen werden. Idealerweise wird ein entsprechendes Unterstützungsangebot bei Bedarf unmittelbar empfohlen und steht innerhalb kurzer Zeit zur Verfügung.
Patienten-Erfahrung: Akzeptanz und Selbst-Management
„… Wenn man seine Diagnose erhält, ist die Betreuung fantastisch, aber sobald Sie Informationen darüber erhalten haben, wie Sie Ihre Symptome lindern können, gibt es nicht mehr viele neue Informationen - oder Hoffnung – aus irgendeiner Richtung. Man wird ziemlich allein gelassen, damit zurechtzukommen. Ein Leben ohne Hoffnung ist eine schwierige Sache…“
(Michael Bartlett)
„… AATD hat mein Leben völlig verändert. Ich muss auf meine Gesundheit achten,… … Das Leben mit einer seltenen Krankheit hat mich gelehrt, mit Risiken anders umzugehen…“
(Frank Willersinn)
„… Für mich war es sehr wichtig, Atemtechniken zu beherrschen, um die Atemnot im Notfall zu managen, und Techniken zu erlernen, die meinen Brustkorb frei von Schleim halten (durch Atemtherapie und/oder Bewegung)…“
(Marion Wilkens)
Patienten-Bedürfnisse
- Unterstützung bei Krankheits-Akzeptanz,
- Unterstützung beim Umgang mit Hoffnungslosigkeit und Ungewißheit,
- Unterstützung beim Selbst-Management,
- Unterstützung beim Umgang mit Atemnot und Atemnot-Ängsten.
Wünschenswerte Angebote im Rahmen einer Kollaborativen Versorgung
Ein zentrales Thema beim Umgang mit einer chronischen Erkrankung wie AATM ist die Krankheits-Akzeptanz. Es gibt inzwischen erprobte Akzeptanz-fördernde Interventionen, die sowohl in einer Einzel-Therapie als auch in einem Gruppen-Setting angeboten werden können.
Da Akzeptanz eine Bereitschaft ist, die nie „für immer und ewig“ erreicht wird, sondern allenfalls für die jeweilige konkrete Situation, sollten Akzeptanz-fördernde Interventionen eigentlich zum obligatorischen Angebot in der Kollaborativen Versorgung von AATM-Patienten und ihren Angehörigen zählen.
Der AATM-Patient Michael Bartlett spricht zudem das Thema „ohne Hoffnung leben“ an. Eng damit verknüpft ist das Thema „mit Ungewißheit leben“.
Beide Themen berühren psychische und geistige Aspekte, die auch im Rahmen der Akzeptanz eine Rolle spielen. Sie können bei Bedarf jedoch auch einzeln betrachtet und bearbeitet werden – zum Beispiel mit Hilfe von Interventionen aus dem Repertoire der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) oder mit einer gezielten „Ungewißheits-Intervention“.
Manche AATM-Patienten profitieren von Unterstützung, wenn das Selbst-Management zu wünschen übrig läßt. Psychomentale Probleme mit dem Selbst-Management können ganz unterschiedliche Gründe haben: Antriebsmangel, Niedergeschlagenheit, aber auch Unsicherheiten oder Ängste.
Ein Beispiel für eine Intervention zur Stärkung des Selbst-Managements ist die Mind-Body-Intervention CART. Sie zielt auf Atemmuster und Atem-Wahrnehmung und kann so Atemnot-Ängste wirksam mindern. Im Blog-Beitrag „Atemnot-Ängste bei COPD: Eine neue Mind-Body-Intervention zielt auf Atemmuster und Atemwahrnehmung“ erfährst Du die Hintergründe und die Wirkweise dieses Angebotes im Rahmen der Kollaborativen Versorgung.
Vorteile des Kollaborativen Ansatzes für Akzeptanz und Selbst-Management
Die Vorteile des Kollaborativen Ansatzes für die Stärkung von Krankheits-Akzeptanz und Selbst-Management liegen auf der Hand. Wer einem AATM-Patienten wirksame Unterstützung in diesen beiden Bereichen anbieten will, kann das nur mit einem umfassenden, multidimensionalen Ansatz tun. Denn Akzeptanz und angemessenes Selbst-Management fordern die körperliche, die psychische, die geistige und die soziale Dimension des Patienten.
Wie es mit den Patienten-Erfahrungen im Krankheitsverlauf weitergeht, erfährst Du im letzten Blog-Beitrag dieser Reihe: „Alpha-1-Antitrysin-Mangel und die Psyche: Belastungen – Bedürfnisse – Behandlungsperspektiven (Teil 3)“
Themenverwandte Beiträge
Beitragschronik
- Erstveröffentlichung: 8.2.2022
Quellen:
- Wilkens, M., Bartlett, M., Willersinn, F., O'Hara, K., Boyd, J., & Denning, J. (2021). The patient perspective of alpha-1 antitrypsin deficiency: disease burden and unmet needs. Breathe, 17(1).
Deine Fragen und Anmerkungen, Deine Kritik und Deine Themenwünsche sind herzlich willkommen!